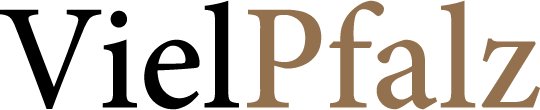Ciao, Servus, Tschüss

Das VielPfalz-Team hat die Koffer gepackt. Die Reise geht zu anderen Zielen weiter. Unser Foto - aufgenommen im Eisenbahnmuseum der Pfalz in Neustadt an der Weinstraße - zeigt die symbolische Abfahrt.
Nach einem Jahrzehnt VielPfalz und nach mehr als 45 journalistischen Berufsjahren war es für den Herausgeber an der Zeit, eine ruhigere Lebensphase anzutreten. VielPfalz ist deshalb mit der Ausgabe 6/2025 (Dezember/Januar) zum letzten Mal erschienen. Auch die Website mit ihrem Veranstaltungskalender und Onlineshop wird nicht mehr betrieben.
Wir bedanken uns bei allen, die mit uns viel Pfalz erlebt haben.
(Foto: Melanie Hubach)